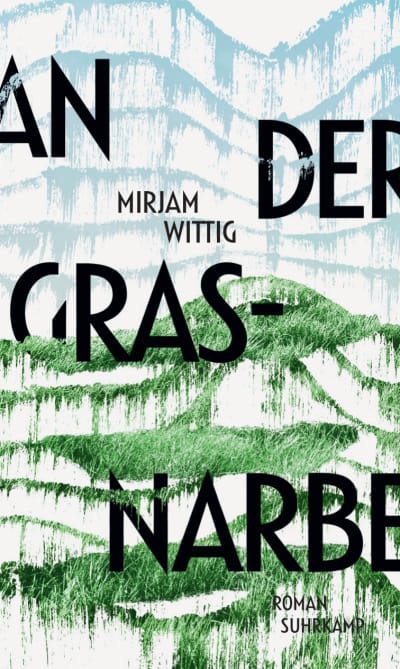5 Fragen an Mirjam Wittig zu An der Grasnarbe

Noa kommt mit viel Angst in diese neue Landschaft. Und lernt sie zunächst gar nicht so sehr als erholsame Idylle kennen, sondern vor allem über die Arbeit auf dem Hof: Sie lernt, Äcker anzulegen, Pflanzen zu setzen, und den Umgang mit den Schafen. Sie freundet sich außerdem mit Jade an, dem elfjährigen Mädchen dort, und erlebt die Situation einer dreiköpfigen Familie mit, die sich in den Bergen einen Lebenstraum erfüllt hat, in dem sie nun festhängt. Noa feiert die Feste der Gegend, schaut einer Schlachtung zu und wird – nach vielen Wochen der Hitze und Dürre – schließlich Zeugin einer großen Flut. Sie ist involviert. Das heißt zwar, dass sie sich oft um den vor Trockenheit aufreißenden Boden sorgt. Es heißt aber auch etwas ganz anderes: nämlich, dass sie aufgehoben ist in diesen Abläufen und dieser Gegend.

Beim Lesen ist es, als ob man die Berge und Täler vor sich sieht, die Pflanzen fühlt und riecht, die Schafsglocken hört, die Trockenheit und Hitze auf der Haut spürt. Wie sind Sie beim Schreiben vorgegangen, um diese Atmosphäre zu erzeugen?
Im Grunde ist es ziemlich banal: Um einen mobilen Weidezaun zu beschreiben, hilft es, ihn einmal selbst auszuwickeln und Erfahrungen mit seinem Material zu machen, Erfahrungen damit, wann er hält und wann er kaputt ist (ihn vielleicht an einer Stelle heimlich offen zu lassen usw.). Im Schreiben über Natur und Landschaften ist das ein ziemlich altes Gebot, sich in das Feld, das in den Text soll, erst einmal mit dem eigenen Körper einzubringen. Ich glaube nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Aber ich finde es in der Regel einfacher, einen Baum zu erfinden, wenn er nicht ganz losgelöst, sondern eine Art Nachbar von mir ist, ein Bild knapp neben einem Bild, das ich kenne. Und das Schreiben, das mich reizt, verlangt mich als praktischere und mutigere Person, als ich es sonst vielleicht wäre.


Was steckt hinter dem Titel Ihres Romans?
Die Grasnarbe bezeichnet die Pflanzendecke des Bodens. Gibt man diesen Begriff im Internet ein, kommen lustigerweise erst einmal Anleitungen zum Verlegen von Rollrasen oder für die Arbeit am städtischen Vorgarten. Das liegt daran, dass, bevor Erde kultiviert werden kann, häufig erst die oberste Schicht des Bodens entfernt werden muss, die von Gras, Moos und Kräutern so fest durchwurzelt ist, dass sie zusammenhält wie ein Teppich oder eine Decke. Mich erinnert diese oberste Schicht auch an die Ablagerung von Bildern, gedanklichen Reflexen und Ängsten, die man* am liebsten abreißen, loswerden, wegwerfen würde. In Noas Fall ist das eine rassistische Angst und die verwirrende und durchaus alberne, spezifisch weiße Verletzung, die damit zusammenhängt: der Schock darüber und die Kränkung, die darin liegt, dass der eigene Blick menschenverachtend sein kann. Das Ausstechen der Grasnarbe hat etwas Brutales, die Narbe aber natürlich auch etwas von einer Naht, also Verbindungsstelle nach einer Verletzung. Mir gefällt das Zusammenfallen von Versehrtheit und etwas Harmlosem wie Gras in diesem Wort.


Wir erleben Noa, wenn sie mit den Auswirkungen der Klimakrise, aber eben auch mit ihren inneren Widersprüchen zu kämpfen hat. Inwieweit reagiert das auf Themen und Herausforderungen der Gegenwart und bildet nicht nur etwas Persönliches ab? Was war Ihnen wichtig?
Mir war wichtig, dass es keine saubere, individual-psychologische Auflösung für Noas persönliche Ängste gibt, dass also die Suche nach dem einen traumatischen Knoten in ihrer Biografie eine untergeordnete beziehungsweise gar keine Rolle spielt. Noa ist keine traumatisierte und eigentlich überhaupt keine sonderlich bedrohte Person, und trotzdem gerät sie in diese psychischen Ausnahmesituationen der Panik. Solche Zustände interessieren mich als Reaktionen auf die Dissonanzen unserer Gegenwart – innere Widersprüche finde ich eine logische Antwort auf äußere. Noa reagiert auf das Rauschen eines überkomplexen Alltags mit einer Angst, deren trigger sich im Laufe der Zeit verändert, und mit der Sehnsucht nach Einfachheit. Dass es mit der Vereinfachung jedoch nicht besonders einfach ist, erfährt sie dann in mehrerlei Hinsicht: Einerseits ist das Land keine »Rückseite« – einige Riesenprobleme der global durchindustrialisierten Welt wie die Klimakrise sind hier für sie sogar besonders unmittelbar spürbar. Und andererseits ist eine Person wie Noa, die sich selbst als weltoffen begreift, eben kein bisschen frei von verinnerlichten Rassismen. Eine Frage, die mich auf jeden Fall auch selbst beschäftigt hat, hat mit dem Impuls zur Weltflucht zu tun: Ist der Wunsch nach Rückzug legitim, ist er immer einfach nur feige oder kann er, wie Gregor im Roman argumentiert, sogar politisch sein?


An der Grasnarbe ist Ihr Romandebüt. Gab es beim Schreiben Vorbilder?
Die Autor:innen, deren Arbeit mich berührt oder die ich extrem bewundere, machen meistens ziemlich andere Sachen als ich – hier eine völlig durcheinandergeworfene und sehr unvollständige Liste der Bewunderung (mal für einen einzelnen Satz, mal für so eine Art Gesamt-Einsatz): Aglaja Veteranyi, Maggie Nelson, Audre Lorde, Esther Kinsky, Donna Haraway, Enis Maci, Sivan Ben Yishai, Sasha Marianna Salzmann, Stacy Alaimo, Mely Kiyak, Johanna Hedva, Henri Bergson, Emmanuel Lévinas, Carla Cerda, Maren Kames, Heinrich von Kleist, Dorothee Elmiger, Jonas Eika, Mariana Enríquez, Carmen Maria Machado, Ocean Vuong, Virginia Woolf, Dmitrij Kapitelman u. v. a.

Alle Fotos: © Mirjam Wittig
Weitere Informationen zum Buch
Jetzt hütet Noa also Schafe. Um ihren Angstattacken in der Großstadt zu entfliehen und aus Sehnsucht nach dem einfachen Leben ist sie als freiwillige Helferin auf einen Hof nach Südfrankreich gekommen. Doch das wird immer beschwerlicher, die Sommer werden heißer. Das Landleben zeigt sich nicht weniger aufreibend als Noas früheres Leben. Und in der Abgeschiedenheit der Berge holen sie auch die Ängste und inneren Widersprüche ein, mit denen sie bereits zuhause zu kämpfen hatte.
Mirjam Wittig erzählt mit großem Einfühlungsvermögen und starker atmosphärischer Kraft von inneren und äußeren Landschaften, die nicht nur durch die Klimakrise ins Wanken geraten – als ob man die Berge und Täler vor sich sieht, die Schafsglocken hört, Trockenheit und Hitze auf der Haut spürt. Ein aufregendes Debüt!