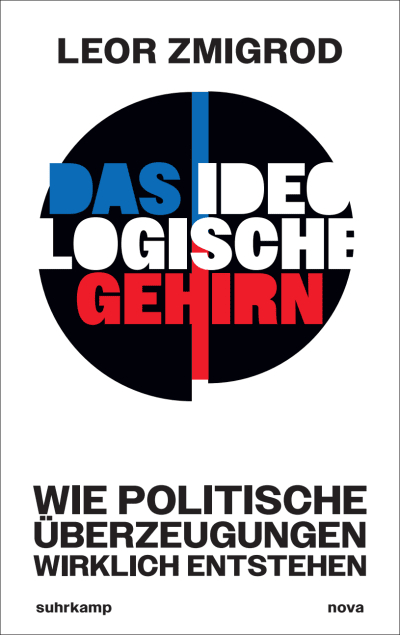4 Fragen an Leor Zmigrod zu Das ideologische Gehirn

Die politische Neurowissenschaft ist ein spannendes neues wissenschaftliches Feld, das Methoden der Neurowissenschaft, der kognitiven Psychologie und sogar der Genetik nutzt, um den Ursprüngen politischer Überzeugungen auf den Grund zu gehen. Die zentrale Frage, die ich mit der politischen Neurowissenschaft beantworten möchte, lautet: Warum sind manche Menschen besonders anfällig für ideologischen Extremismus? In Das ideologische Gehirn zeige ich, wie eine psychologische und biologische Perspektive uns dabei helfen kann, zu verstehen, warum bestimmte Gehirne besonders empfänglich für extreme und dogmatische Ideologien sind und was andere Gehirne widerstandsfähiger gegenüber autoritären Weltanschauungen macht.
Ihr Buch trägt einen der zentralen Begriffe bereits im Titel: Ideologie. Was verstehen Sie darunter – auch im Unterschied zum Begriff »Kultur«?
Während sich die meisten Definitionen von Ideologien auf historische Strömungen und soziologische Bewegungen konzentrieren, interessiere ich mich dafür, Ideologien als psychologische Phänomene zu betrachten. Diese psychologische Perspektive erlaubt es uns, zu fragen, was eine Ideologie mit ihren Anhängern macht und wen sie besonders leicht in ihren Bann zieht. Ideologisches Denken ist eine Denkweise, die strengen mentalen Regeln und sorgfältig reglementierten Denksprüngen unterworfen ist. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Kultur und Ideologie: Ideologien bieten absolutistische Beschreibungen der Welt sowie klare Vorschriften, wie wir denken, handeln und mit anderen interagieren sollen. Sie legen fest, was erlaubt und was verboten ist. Im Gegensatz zur Kultur, die Exzentrik und Neuinterpretationen würdigen kann, ist bei einer Ideologie Nonkonformität nicht tolerierbar und eine totale Anpassung unerlässlich. Wenn Abweichungen von den Regeln zu harter Bestrafung und Ausgrenzung führen, haben wir uns von der Kultur weg und hin zur Ideologie bewegt.
Sie schreiben, dass Ideologien unser Gehirn verändern – und gleichzeitig unser Gehirn uns für bestimmte Ideologien empfänglich macht. Können Sie dieses Zusammenspiel an einem Beispiel erläutern?
In Das ideologische Gehirn lege ich dar, wie die Auseinandersetzung mit starren Ideologien buchstäblich die Funktionsweise unseres Gehirns verändern kann und dass die Eigenschaften bestimmter Gehirne diese besonders anfällig für autoritäre Ideologien machen. Ein Experiment, das zeigt, wie Ideologien unsere physiologischen Reaktionen auf die Welt wirklich beeinflussen können, hat sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie sehr Menschen unter Ungleichheit leiden. Manche Menschen glauben, große Ungleichheiten seien natürlich, gerechtfertigt oder sogar wünschenswerte Aspekte unserer Gesellschaft, während andere sie weder für natürlich noch für gerecht halten und finden, dass sie korrigiert werden sollten. In diesem Experiment maßen Forscher die Herzfrequenz und andere physiologische Marker der Teilnehmenden, während sie Videos über soziale Ungerechtigkeit sahen – etwa obdachlose Menschen, die über ihre herausfordernden Lebensumstände berichteten. Diejenigen, die soziale Ungleichheit als problematisch empfanden, reagierten mit starker körperlicher Erregung: ihre Herzfrequenz stieg, ihre Körper zeigten ihre Bestürzung. Im Gegensatz dazu zeigten Menschen, die soziale Hierarchien als gerechtfertigt betrachten, kaum körperliche Reaktionen wie Bestürzung, Traurigkeit, Wut oder Mitgefühl. Anhänger hierarchisch strukturierter Ideologien können gegenüber Ungerechtigkeiten und fremdem Leid regelrecht abstumpfen. Das zeigt: Ideologien sind keine bloßen Hüllen unseres Lebens – sie dringen in unsere Haut, unser Gehirn, unsere Nervenzellen ein. Das bringt die Gefahr mit sich, dass sich nicht nur politische Meinungen und moralische Überzeugungen verändern, sondern das gesamte Gehirn umgestaltet wird.
Was sagt es über einen Menschen aus, wenn er besonders einfallsreich mit einer Büroklammer umgehen kann? In Ihrem Buch legen Sie nahe: überraschend viel. Wie hängen spielerisches Denken und politische Offenheit zusammen – und was sagt das über unsere ideologischen Überzeugungen aus?
Eines der überraschendsten und aufschlussreichsten Ergebnisse meiner Studien war, dass die Flexibilität, mit der Menschen sich unkonventionelle Verwendungsmöglichkeiten für Alltagsgegenstände – etwa eine Büroklammer oder eine Zeitung – vorstellen können, Rückschlüsse auf ihre ideologische Beweglichkeit zulässt. In Studien mit tausenden Teilnehmenden zeigte sich: Mentale Flexibilität in solchen Kreativitätstests steht in direktem Zusammenhang mit einer Ablehnung von Dogmatismus – also mit intellektueller Demut. Je flexibler die Menschen bei verschiedenen Versionen dieses sogenannten „Alternative Uses Tests“ abschneiden, desto offener sind sie gegenüber alternativen Sichtweisen. Und desto eher sind sie bereit, ihre Überzeugungen im Lichte verlässlicher Informationen zu überdenken. Umgekehrt gilt: Je kognitiv rigider Menschen sind, desto ideologisch starrer denken sie auch. Das zeigt: Die Beschaffenheit unserer Vorstellungskraft – ob flexibel und offen oder eng und geschlossen – sagt viel über die Art unserer politischen Vorstellungskraft aus. Mentale Flexibilität im Alltag schützt uns vor extremistischem Denken.
Zum neuen Buch von Leor Zmigrod
Leor Zmigrod gilt mit nur 29 Jahren als Begründerin eines neuen Wissenschaftsfelds: der politischen Neurobiologie. Darin erforscht sie den Zusammenhang zwischen politischen Einstellungen und der Biologie unseres Gehirns. Sie zeigt, dass unsere Überzeugungen nicht als flüchtige Gedanken losgelöst von unseren Körpern existieren. Vielmehr verändern Ideologien unser Gehirn. Und zur gleichen Zeit macht eine bestimmte neurobiologische Veranlagung empfänglich für gewisse Glaubenssätze. Weshalb sie mit einem einfachen Kartensortier-Experiment beispielsweise in der Lage ist, erschreckend akkurat auf die Weltsicht ihrer Probanden zu schließen. In zahlreichen weiteren Experimenten beweist sie den Konnex zwischen extremen politischen Positionen und unserem Gehirn und revolutioniert damit unsere Vorstellungen von Radikalisierung, Extremismus, demokratischer Meinungsbildung.
Das ideologische Gehirn leistet unverzichtbare Aufklärung in Zeiten maximaler Polarisierung. Die Wissenschaftlerin und Pionierin der politischen Neurobiologie Leor Zmigrod etabliert ein neues Verständnis davon, wie unsere Überzeugungen entstehen und was wirklich helfen kann im Kampf gegen das, was unsere Demokratie grundlegend gefährdet.