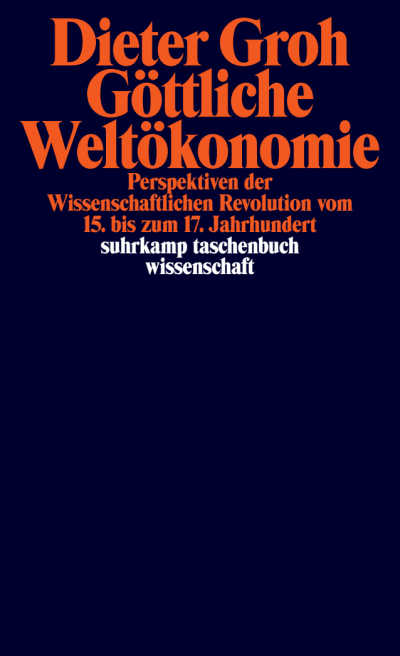Göttliche Weltökonomie
»Göttliche Weltökonomie« ist eine auf die Stoa zurückgehende Begriffsbildung, die dazu diente, Bau und Struktur des Weltganzen philosophisch oder theologisch zu beschreiben. Diese »Oikonomia« Gottes – verstanden als Heilsplan und zugleich teleologisch konzipiertes Ganzes der Schöpfung – bildet den Leitfaden des zweiten Bandes von Dieter Grohs großer Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und modernen Wissenschaften. Seine Grundthese lautet: Die modernen Wissenschaften sind nicht aus...
»Göttliche Weltökonomie« ist eine auf die Stoa zurückgehende Begriffsbildung, die dazu diente, Bau und Struktur des Weltganzen philosophisch oder theologisch zu beschreiben. Diese »Oikonomia« Gottes – verstanden als Heilsplan und zugleich teleologisch konzipiertes Ganzes der Schöpfung – bildet den Leitfaden des zweiten Bandes von Dieter Grohs großer Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und modernen Wissenschaften. Seine Grundthese lautet: Die modernen Wissenschaften sind nicht aus einem Prozeß der Säkularisierung hervorgegangen, sondern aus dem Versuch, jene göttlichen Gesetze, die die regelhaften Abläufe in Natur und Menschenwelt zu bestimmen schienen, zu entdecken und zu formulieren.
1.0 Die anthropozentrische Wende der Renaissance – eine kulturelle »Revolution ohne Revolution«?
1.1 Diskontinuität oder Kontinuität der Wissenschaftsentwicklung?
1.2 »Renaissance der Mathematik«, Kunst der Renaissance und Zentralperspektive
1.2.1 Mathematik
1.2.2 Der Künstler als »alter deus«
1.2.3 Arabische Sehtheorie und westliche Zentralperspektive
1.3 Nicolaus Cusanus
1.3.1 Einheit der Gegensätze – empirisches Wissen und ideales Sein
1.3.2 Einflüsse und Studium
1.3.3 Cusanus’ Anthropologie als »Gipfel des humanistischen Optimismus«
1.3.4 Wirkung bis hin zur New Science
1.4 Die Renaissancehumanisten in Italien
1.4.0 Einleitung: Platonismus versus Aristotelismus?
1.4.1 Coluccio Salutati
1.4.2 Giannozzo Manetti: Der Mensch als »sterblicher Gott«. Der Beginn der ›dignitas‹-Literatur
1.4.3 Lorenzo Valla: Rhetorik als die wahre Philosophie?
1.4.4 Marsilio Ficino
1.4.5 Giovanni Pico della Mirandola
1.4.6 Ein Blick nach Frankreich: Pierre Boaistuau und Carolus Bovillus
Kap. 2 Nicolaus Copernicus: Die Janusköpfigkeit eines neuen Weltentwurfs
2.0 Centrum terrae non esse centrum mundi: »Ein neuer Himmel, eine neue Welt«?
2.1 Exkurs: Griechen, Römer, Araber
2.1.1 Griechische Astronomen
2.1.2 Arabische Astronomen
2.1.3 Kontakte zwischen Abend- und Morgenland
2.2 Auf dem Weg in eine andere Welt
2.3 Die Biographie von Copernicus
2.3.1 Rückkehr ins Ermland und dortige Tätigkeiten
2.3.2 Rufschädliche Affären
2.4 Wissenschaftliche Ausbildung und Einflüsse
2.4.1 Neoplatonismus und Aristotelismus
2.4.2 Arabische Einflüsse
2.5 Astronomische Studien
2.5.1 Publikationsgeschichte
2.5.2 »Gemäß Gesetz verlauf das All und wird erkannt so«. ›De Revolutionibus‹
2.6 Mittelpunkt, Kugel, Bewegung
2.6.1 Kugelform der Erde
2.6.2 Mittelpunkt des Universums?
2.6.3 Heliozentrismus bereits in Krakau?
2.7 Nikolaus von Kues – ein »Vorläufer« von Copernicus?
2.8 Eine Revolution durch »Rettung der Phänomene«?
2.8.1 Verwirrung und Verirrung im Bereich des Physikalisierungsprogramms
2.8.2 Eine neue Basis für viele Wissenschaften: die Mathematik
2.9 »Ein neuer Himmel, eine neue Welt«?
2.9.1 Eine »Copernikanische Revolution«?
Kap. 3 Zürich Vorspiel: Heinrich Bullingers Bundestheologie, eine Brücke zwischen dem Kontinent und England
3.0 Einleitung: Werdegang und Wirken des Schweizer Reformators
3.1 Bundestheologie als Zentrum
3.1.1 Der Bund zwischen Gott und Mensch, Zentrum der Bundestheologie
3.1.2 Die Einheit des Bundes, der Schrift und der Kirche in der Ausrichtung auf Christus
3.2 Sünde und Glaube: Das Geschenk der guten Werke
3.2.1 Erb-Sündenlehre
3.2.2 Soteriologie: der Heilswille Gottes
3.2.3 Erwerb des Glaubens und restitutio der Gottebenbildlichkeit
3.3 Prädestination als Heilsangebot durch und in Christus
3.4 Schöpfungstheologie
3.4.1 Ordnung der Schöpfung und göttliche Güte
3.4.2 Erkenntnis Gottes aus der Natur?
3.5 Geschichte als Heilsgeschichte in eschatologisch-apokalyptischer Perspektive
3.5.1 Geschichtsbild und Endzeitbewusstsein
3.5.2 Verbreitung der »wahren Lehre« und Systematisierung des Wissens
3.5.3 Pastoraltheologie und Bildungsprogramm
3.6 Bullingers Beziehungen zu England: Der Transfer der Zürcher Reformation
3.6.1 Persönliche Kontakte und Briefwechsel
3.6.2 Verbreitung von Bullingers Theologie im Elisabethanischen England: ›Dekaden‹ und apokalyptische Schriften
Kap. 4 Englisches Vorspiel: Die apokalyptische Tradition im England der frühen Neuzeit, weltgeschichtlicher Dualismus von Gut und Böse und neuer Millenarismus
4.0 Einleitung
4.1 Die zentralen Referenzstellen und ihre Geschichte: Danielapokalypse, Johannesoffenbarung, Thessalonicherbriefe
4.1.1 Die jüdische Danielapokalypse
4.1.2 Die christliche Johannesapokalypse
4.1.3 Die Thessalonicherbriefe als Quelle apokalyptischer Spekulationen
4.1.4 Die tausendjährige Fessel Satans und das tausendjährige Reich
4.2 Von der pessimistischen zur optimistischen Eschatologie
4.3 Hebräische Studien und das Schicksal des jüdischen Volkes
4.4 Apokalyptische Geschichtsdeutung und der Kampf zwischen Gut und Böse
4.4.1 John Bale (1495-1563)
4.4.2 John Foxe (1516/17?-1587)
4.4.3 John Knox (1514-1572)
4.5 Optimistische millenaristische Zukunftserwartungen
4.5.1 Sieg der Gläubigen und Ausbreitung der wahren Lehre am Ende der Geschichte
4.5.2 Wissenschaftsoptimismus
4.6 Das Millennium als irdisches Reich vor dem Ende der Welt
4.6.1 Thomas Brightman (1557-1607)
4.6.2 John Napier (1550-1617)
4.6.3 Joseph Mede (1586-1638)
4.6.4 Thomas Goodwin (1600-1680)
4.7 Das auserwählte Volk und die Errichtung des Gottesreiches durch weltliche Agenten
4.8 Die »Fifth Monarchy Men«
Kap. 5 Francis Bacon oder: Wissenschaft als Kompensation der Folgen der Sünde
5.0 Einleitung
5.0.1 Felix culpa, der Heilsplan Gottes, das »Improvement of Learning«
5.0.2 Die Organisation der Wissenschaft
5.1 Religion und Wissenschaft
5.1.1 Das Millennium als Reich des Wissens
5.1.2 Wissenschaft als Kompensation der Folgen der Sünde: Die »Maker’s Knowledge«-Tradition
5.1.3 Die Aufgabenbereiche von Naturphilosophie und Religion
5.1.4 Das Caritasideal in der (Natur-)Wissenschaft und Bacons »Utilitarismus«
5.1.5 Exkurs: Bacons Traum und sein Scheitern
5.2 ›Instauratio Magna‹: Bacons »Große Erneuerung« als Versöhnung von Theorie und Praxis
5.2.1 Kritik am Wissenschaftsbetrieb und die Bedeutung des Neuen
5.2.2 »Geistiger Urahne der Experimental Philosophy« und die Royal Society?
5.3 Zum Umgang des Menschen mit der Natur
5.3.1 »Formen« und Naturgesetze
5.3.2 Unterwerfung der Natur oder Unterwerfung unter die Natur?
5.4 ›Nova Atlantis‹: Der zentrale Text Bacons und sein letztes Wort?
5.4.0 Einleitung
5.4.1 Organisation des Ordens
5.4.2 Die Stellung der ›Nova Atlantis‹ in Bacons Wissenschaftsprogramm
5.4.3 Die Realisierung humanistischer Intentionen »auf dem Weg der Macht«?
Kap. 6 Zurück zum Kontinent: Universalwissenschaft, Millenarismus und Zweite Reformation
6.0 Einleitung
6.1 Johann Arndt (1555-1621): ›Vier Bücher vom wahren Christentum‹
6.1.1 Arndts Werdegang zwischen lutherischer Amtskirche, Paracelsischer Hermetik und mystisch-spiritualistischen Strömungen
6.1.2 Die ›Vier Bücher vom wahren Christentum‹
6.1.3 Zur Stellung Arndts in der protestantischen Theologie
6.2 Johann Heinrich Alsted (1588-1638) und die enzyklopädische Ordnung der Dinge im kommenden Millennium
6.2.1 Leben und Wirken als Professor der calvinistischen Hohen Schule in Herborn
6.2.2 Millenaristische Wiederherstellung der Schöpfungordnung durch Systematisierung des Wissens
6.3 Johann Valentin Andreae (1586-1654) und die Zweite Reformation
6.3.0 Einleitung
6.3.1 Andreaes Lebenslauf: Christliches Reformstreben im literarischen und kirchenpolitischen Wirken und in den Sozietätsbestrebungen
6.3.2 Andreaes phantastische Frühschriften und das Rosenkreuzertum
6.3.3 Eine christliche Gesellschaft auf der Basis von Wissenschaft und Erziehung
6.3.4 Andreaes Sozietätsbemühungen und die Wirkung seiner Utopie einer christlichen Gesellschaft
6.4 Jan Amos Comenius (1592-1670): die Pansophie und das Reich Christi auf Erden
6.4.0 Einleitung
6.4.1 Der Weg des Wissens als Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit
6.4.2 Pansophie als Vereinigung von Wissen und Handeln: Die Mitwirkung der Menschen am Kommen des Reiches Christi
6.4.3 Die Rezeption von Comenius in England
Kap. 7 Die Gründung der Royal Society: Millenaristische Hoffnungen, Glaube an eine Verbesserung der conditio humana und eine Abwehrschlacht gegen den »Atheismus« mittels der Boyle Lectures
7.0 Einleitung
7.0.1 Zur Geschichte der Deutungen der Royal Society
7.0.2 Vorläufer und Hintergrund
7.1 Diskussionszirkel in London – Vorläufer und Basis für die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft
7.1.1 Der »Hartlib Circle«
7.1.2 Die »Londoner Gruppe« oder »Wallisgruppe« von 1645
7.1.3 Robert Boyles »Invisible College«
7.2 Das universitäre Umfeld
7.2.1 Cambridge: Platonismus, Cartesianismus und die latitudinarische Verbindung von Naturforschung und Religion
7.2.2 Oxford und der Club zur Förderung experimenteller Forschung
7.3 Das Gresham College und die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft im Jahr 1660
7.3.1 Sozialer Hintergrund und Stiftung
7.3.2 Mittlerfunktion zwischen Theorie und Praxis
7.3.3 Exemplarische Biographien
7.3.4 Die Gründung
7.4 Etablierung und frühe Selbstdeutung: Methoden und Themenvielfalt sowie breite Rekrutierungsbasis der »Christian Virtuosi«
7.5 Die hohe Zeit der Boyle Lectures 1692-1724
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Namenregister
Sachregister
rtsregister
Bibelstellenregister
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Personen für Göttliche Weltökonomie
Dieter Groh
Dieter Groh war Professor emer. an der Universität Konstanz. Im Suhrkamp Verlag sind u. a. erschienen: Schöpfung im Widerspruch. Deutungen der Natur und des Menschen von der Genesis bis zur Reformation (stw 1489), Anthropologische Dimensionen der Geschichte (stw 992), Weltbild und Naturaneignung (zusammen mit Ruth Groh, stw 939). Dieter Groh ist am 29. Juli 2012 in Heidelberg gestorben.
Dieter Groh war Professor emer. an der Universität Konstanz. Im Suhrkamp Verlag sind u. a. erschienen: Schöpfung im Widerspruch. Deutungen der...