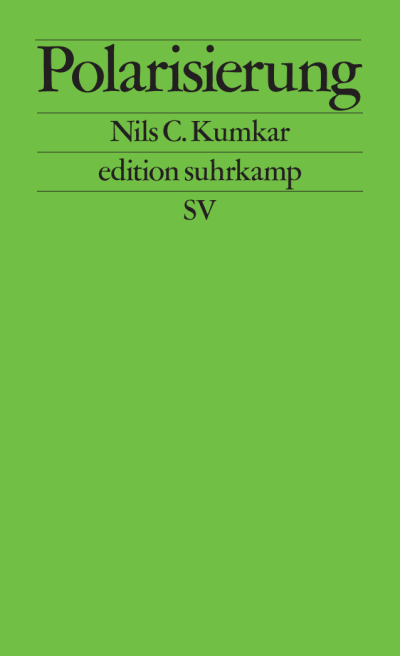Nils Kumkar, was ist Polarisierung? | Polarisierung kurz erklärt
Das neue Buch des Soziologen
Nachdem er sich zuletzt mit »alternativen Fakten« befasste, widmet sich Nils C. Kumkar nun einem anderen Aspekt, der die Debatte über die Debatten verwirrt. Er zeigt, dass die Beobachtung der Gesellschaft notwendigerweise Polarisierung wahrnimmt, da Letztere im politischen System mit seinen Unterscheidungen zwischen Regierung und Opposition sowie zwischen Regierenden und Regierten angelegt ist. Spaltung, so Kumkar, lässt sich letztlich nicht überwinden. Die Frage wäre, wie man produktiver spalten kann.
Nils Kumkar im Interview: Warum Spaltung und Polarisierung nicht gleichbedeutend ist
Herr Kumkar, was verstehen Sie unter Polarisierung?
Polarisierung ist zunächst mal eine gesellschaftliche Sorge. Es gibt eigentlich keinen politischen Akteur, keinen Feuilleton‑Redakteur, der sich nicht darum sorgen würde, dass die Gesellschaft polarisiert ist. Ich habe in meiner Forschung beobachtet, dass das, was die Leute sorgt, wenn sie sich um Polarisierung sorgen, in erster Linie politische Kommunikation ist. Und zwar politische Kommunikation, die unter der Maßgabe operiert, es gäbe einen zugrunde liegenden, tiefgreifenden Konflikt. Also von kommunikativer Polarisierung spreche ich in dem Buch immer dann, wenn politische Kommunikation so funktioniert, dass die Akteure sich gegenseitig unterstellen, dass es Sinn macht, ihre Kommunikation so zu verstehen, dass es schon einen Konflikt gibt, in dem man die Leute eigentlich nur noch einsortieren muss.
Viele sprechen von einer »gespaltenen Gesellschaft«. Wie unterscheidet sich Polarisierung von der gesellschaftlichen Spaltung?
Im Alltagssprachgebrauch ist das mehr oder minder dasselbe. Wenn Leute sich darum sorgen, dass die Gesellschaft gespalten ist, dann sorgen sie sich meistens auch darum, dass sie polarisiert ist, und definieren tun sie es sowieso nicht. Man kann, glaube ich, sinnvoll sagen, dass das, was »ideologische Polarisierung« in der Forschung genannt wird — also die Idee, dass die Meinungen in der Bevölkerung systematisch auseinandergehen, dass es zwei Lager gibt, die sich auseinandergesortet haben, bei denen die einen zu allen Themen eine Meinung haben und die anderen zu allen Themen dann die jeweils andere Meinung —, das ist im Alltag oft gemeint. Kommunikative Polarisierung funktioniert anders, weil es da gar nicht primär um die Meinung der Menschen geht, sondern um die Art, wie Akteure miteinander kommunizieren. Also wenn ich mir angucke, wie Akteure miteinander kommunizieren, dann stellt man ganz oft fest, dass sie sich sogar selber vermutlich alle in der Mitte einordnen würden. Ob das stimmt, ist dann nochmal eine andere Frage, aber ein Großteil vielleicht wirklich. Dass sie aber miteinander reden, als wäre schon ausgemacht, wer zu welchem Lager gehörte – als wäre das so einfach. Also kommunikative Polarisierung ist auch eine grandiose Vereinfachungsleistung politischer Kommunikation und Spaltung ist dann so ein bisschen die Fantasie, die man dazu abruft.
Welche Akteure profitieren besonders stark von Polarisierung?
Also alle politischen Akteure in modernen, sich massenmedial selbst beobachtenden Publikumsdemokratien betreiben irgendwie Polarisierung. Und es ist ganz, ganz schwer zu sagen, wer am meisten profitiert. Also die Politikerin, die sich hinstellen kann und sagen kann, sie steht über den verfeindeten Lagern, profitiert genauso wie die verfeindeten Lager. Und manchmal gibt es die verfeindeten Lager auch gar nicht, sondern nur die Politikerin, die darüber steht. Zeitdiagnostisch ist auffällig, dass der Aufstieg der extremen Rechten und der Parteien, die wir rechtspopulistisch nennen — und das ist eine unglückliche Zuschreibung in Teilen —, ganz eng damit zusammenhängt, dass es ihnen gelungen ist, sich in dieser kommunikativen Polarisierung als ein Pol in Stellung zu bringen. Also die diskursive Prominenz von Parteien wie der AfD zum Beispiel lässt sich, glaube ich, nicht verstehen, wenn man nicht sieht, wie sie sich in diese Polarisierungsstruktur hineingemogelt haben. Andere Parteien beziehen sich ständig auf sie; kaum ein Parteiprogramm wird nicht damit begründet, wie es gegen die AfD hilft. Und so sind sie viel mehr präsent, als ihr Stimmanteil allein erklären würde. Das heißt nicht, dass die anderen nicht auch profitieren — aber hier wird es sehr markant.
Welche Rolle spielen soziale Medien bei der Wahrnehmung und Verstärkung von Polarisierung?
Das ist schwer nachzuweisen. Also es scheint nicht so zu sein, dass die Nutzung sozialer Medien bei den Nutzerinnen einen relevanten Unterschied in Bezug auf das macht, was sie so denken. Außer in einer Hinsicht: Wer soziale Medien nutzt, und besonders wer Plattformen wie Twitter oder ähnliche Echtzeit‑Netze nutzt, hält die Gesellschaft für polarisierter. Das habe ich in dem Buch versucht auseinanderzufalten: Diese Form von Social‑Media‑Politikkommunikation ist so eine Komplexitätsüberfrachtung, dass Polarisierung dort fast naturwüchsig entsteht — nicht allein, aber sehr wahrscheinlich. Wer diese Diskurse beobachtet, hat dann das Gefühl, hier treffen zwei verfeindete Lager aufeinander, obwohl die Frontverläufe oft viel unklarer sind. Social Media hat die Selbstbeobachtung politischer Alltagskommunikation revolutioniert: Wir können viel mehr Menschen in Echtzeit sehen, wie sie Meinungen äußern; dadurch sehen wir mehr Konflikte, die früher vielleicht auch da waren, aber nicht so sichtbar. Und das führt zu dem Eindruck, es sei alles viel stärker polarisiert.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Polarisierung zwar durchaus gefährlich ist, aber zugleich auch demokratische Teilhabe ermöglicht. Wie meinen Sie das genau?
Das Beispiel mit der Social‑Media‑Kommunikation haben wir gerade schon. Man kann das verallgemeinern: Moderne politische Systeme sind extrem komplex, Parteien müssen viele Interessen bedienen, Politik muss viele Probleme bearbeiten. Es gibt kaum diese Situation, dass jemand sagt: »Das ist meine Partei, das Programm habe ich gelesen, das finde ich gut, die wähle ich jetzt.« Viel öfter wählen Menschen, weil sie die Partei im Konflikt mit anderen Parteien überzeugend finden — also strategisch, um etwa eine bestimmte Partei zu verhindern. Polarisierung ermöglicht eine Art Navigationsstruktur: Wenn man annehmen kann, dass es eine polarisierte Struktur gibt, dann kann fast jeder damit navigieren. Das bindet das Publikum an das politische Spiel; es ermöglicht Teilhabe, die mit den Alltagsressourcen sonst kaum bewältigt wäre. Gleichzeitig hat Polarisierung negative Effekte — sie erleichtert Mobilisierung, erhitzt Debatten und kann demokratische Prozesse belasten. Es ist also ambivalent.
Wie können wir »richtig« polarisieren? Gibt es eine konstruktive Form von Polarisierung, die Demokratien stärkt statt schwächt?
Eine ganz einfache Antwort gibt es nicht. Die wichtigste Einsicht ist: Ohne Polarisierung geht es nicht. Die entscheidende Frage ist, ob es Formen der Polarisierung gibt, die gesellschaftliches Lernen ermöglichen. Polarisierung, die an Themen hängt — etwa ökonomische oder soziale Fragen —, kann das politische System zum Lernen zwingen. Ein historisches Beispiel wäre die Auseinandersetzung zwischen Arbeiterbewegung und konservativen Kräften, die zur Ausbildung des Sozialstaats geführt hat; dort war die Polarisierung an inhaltliche Konflikte gebunden, nicht nur an Machtkämpfe. Rechtspopulistische Polarisierung ist hingegen oft hohl: Sie dreht sich um »die da oben« gegen »wir« und bietet kaum programmatische Alternativen. Wenn Polarisierung stärker an Sachfragen gebunden wäre, könnte das System eher produktiv damit umgehen. Deshalb wäre eine wünschenswerte Polarisierung eine, die einen klaren sachlichen Gegenstand hat — sie bleibt konfliktgeladen, aber sie ermöglicht institutionelles Lernen.