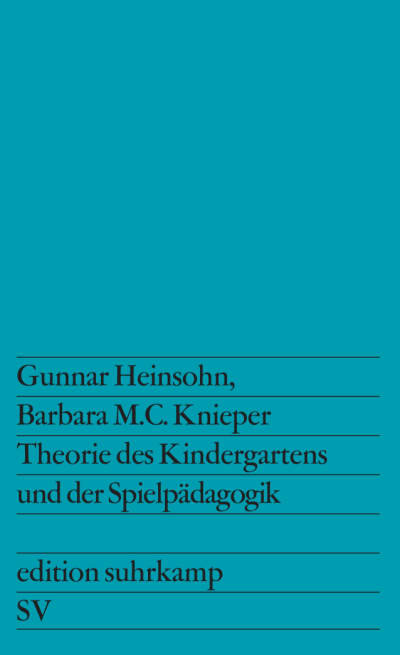Theorie des Kindergartens und der Spielpädagogik
Das Vorhaben der Autoren ist die Strukturanalyse des Kindergartens anhand seines geplanten oder ungeplanten Umgangs mit dem kindlichen Spiel. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß der Kindergarten spielzerstörend wirken und damit einen wichtigen Mechanismus der psychischen Stabilisierung des Kindes so sehr beeinflussen kann, daß die geforderte Entwicklung zur »Realitätstüchtigkeit« nicht gefördert, sondern gefährdet wird. Auf welche Weise der Kindergarten gegen die ihm zugedachten...
Das Vorhaben der Autoren ist die Strukturanalyse des Kindergartens anhand seines geplanten oder ungeplanten Umgangs mit dem kindlichen Spiel. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß der Kindergarten spielzerstörend wirken und damit einen wichtigen Mechanismus der psychischen Stabilisierung des Kindes so sehr beeinflussen kann, daß die geforderte Entwicklung zur »Realitätstüchtigkeit« nicht gefördert, sondern gefährdet wird. Auf welche Weise der Kindergarten gegen die ihm zugedachten gesellschaftlichen Aufgaben wirkt, wird im Rahmen der Untersuchung seiner wesentlichen Strukturen – Lohnerziehung, Kollektivierung, Abgetrenntsein von den für Erwachsene wichtigen Verrichtungen – gezeigt. Dabei wird deutlich, daß die Lohnerziehungs-Struktur den Erzieher zu einer schonenden Verausgabung seiner Arbeitskraft bestimmt, was nicht ohne Folgen für die Anregung oder Duldung kindlicher Verhaltensweisen sein kann. Die Kollektivstruktur führt unter Umständen dazu, daß die Kinder vom Erzieher als Gruppe kommandiert, individuelle Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen behindert werden und daß die Kinder auch untereinander ihre Freispiele stören. Die Abtrennung schließlich von Verrichtungen, die von Erwachsenen ernst genommen werden, wird im Kindergarten in aller Regel mit Beschäftigungsweisen bekämpft, deren Sinnlosigkeit eine zwangsweise Einübung der Kinder in sie geradezu gebietet und die so ihrerseits zur Zerstörung von Spiel und Spielfähigkeit verführen.
II. Warum von der Spielpädagogik die Lösung der Probleme gesellschaftlicher Kleinkinderziehung erhofft wird
III. Wie die bewusst vorangetriebene Kindergartenerziehung sozialistischer Länder bei einer Spieleingriffspädagogik anlangt
IV. Welche praktischen Folgen für die Kinder sich aus den Annahmen der sowjetischen Spielpsychologie ergeben können
V. Warum für die sowjetischen Autoren eine vollendete Spielpädagogik erst mit Kindern der Regelspielphase gelingen kann
VI. Wie man über die Spielzerstörung an Erwachsenen die Beeinträchtigung der Kinder durch die Spieleingriffspädagogik besser verstehen kann
VII. Warum die sowjetische Psychologie und Pädagogik des Kinderspiels sich in den sozialistischen Ländern durchgesetzt haben könnte
VIII. Warum die Spieleingriffspädagogik im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung der sozialistischen Länder nicht mehr aufrecht erhalten werden kann
IX. Wie die fundamentale Kritik an der sowjetischen Psychologie und Pädagogik des Kinderspiels in den sozialistischen Ländern (Bulgarien als Beispiel) verläuft
X. Wie die pädagogischen Postulate der sowjetischen Spielpsychologie dennoch eingelöst werden könnten
XI. Wie über das Spiel, ohne es zu zerstören, gelehrt und gelernt werden kann
XII. Warum mit psychoanalytischen Erkenntnissen über das Kinderspiel allein die Schwierigkeiten der Kindergarten-erziehung nicht beseitigt werden können
XIII. Wie versucht wird, im Kindergarten informationsreiche Eindrücke für die kindliche (Spiel)-Entwicklung herzustellen
XIV. Warum Freispielsujet, Spielzeug und Beschäftigungsmaterial unterschieden werden müssen
XV. Warum Exkursionen häufig ihre Absicht verfehlen und dennoch nicht nutzlos sind
XVI. Wie die Strukturalternative im Haus der Kinder zum erzieherischen Übermachtabbau und zu entsprechenden Spielen führt
XVII. Warum Kinderläden und Elternselbstinitiativen Vorformen für das Haus der Kinder gewesen sind
XVIII. Welchen Stellenwert das Kinderspiel in der Casa dei bambini (Montessori-Konzeption) erhält
XIX. Warum Spielzeug im Haus der Kinder überflüssig wird
XX. Warum auch unter der Strukturalternative im Haus der Kinder nicht auf Wissen über psychische Prozesse verzichtet werden kann (Friedrich Fröbels Leistung)
XXI. Warum die Erhöhung des erzieherischen Qualifikationsniveaus die Schwierigkeiten des Kindergartens nicht löst, solange er strukturell unverändert bleibt
XXII. Wie hohes pädagogisches Engagement - trotz Ablehnung der psychoanalytischen Erkenntnisse über das Kinderspiel - zu einer praktischen Bestätigung dieser Erkenntnisse führt (Am Beispiel: Volkstheater - Kooperative Märkisches Viertel)
XXIII. Warum trotz richtiger Erkenntnisse über das Kinderspiel unter der Lohnerziehungs- und Kollektivstruktur des bestehenden Kindergartens eine zerstörerische Spielpädagogik zustande kommt
XXIV. An welchen Fragestellungen die Strukturanalyse des Kindergartens weitergeführt werden kann
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de