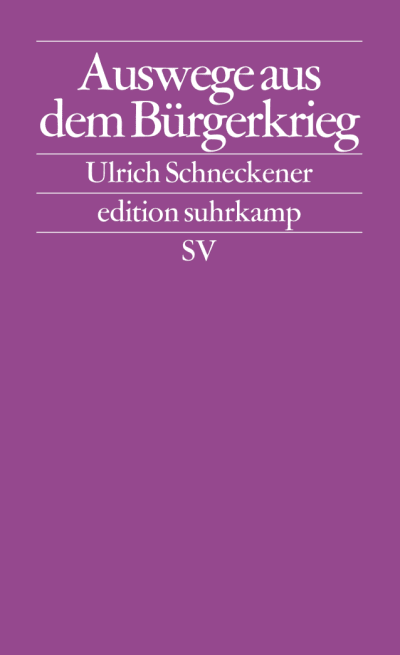Auswege aus dem Bürgerkrieg
Dramatisch zugespitzt durch den Zerfall Jugoslawiens und der Sowjetunion, erlebte Europa eine Zunahme ethno-nationaler, mit Waffen ausgetragener Konflikte. Während ihre Ursachen und die destruktive Eskalation bereits häufig untersucht wurden, fehlt eine systematische Überprüfung für politische Lösungen solcher »neuen Kriege«. Der Ausbruch solcher Kriege kann verhindert werden, indem man vor dem Rückgriff auf Gewalt die friedliche Koexistenz unterschiedlicher ethnischer Gruppen sicherstellt....
Dramatisch zugespitzt durch den Zerfall Jugoslawiens und der Sowjetunion, erlebte Europa eine Zunahme ethno-nationaler, mit Waffen ausgetragener Konflikte. Während ihre Ursachen und die destruktive Eskalation bereits häufig untersucht wurden, fehlt eine systematische Überprüfung für politische Lösungen solcher »neuen Kriege«. Der Ausbruch solcher Kriege kann verhindert werden, indem man vor dem Rückgriff auf Gewalt die friedliche Koexistenz unterschiedlicher ethnischer Gruppen sicherstellt. Da auch nach dem »Ende« der kriegerischen Auseinandersetzungen keinesfalls von Frieden gesprochen werden kann, sind in dieser Situation ebenfalls Modelle für ein Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen erforderlich.
Das vorliegende Buch analysiert in der Praxis erprobte Ansätze zu einer erfolgversprechenden Konfliktregulierung: etwa Vorkehrungen zum Minderheitenschutz, bilaterale Abkommen, Konkordanzmodelle und territoriale Lösungen. Durch den Vergleich gelungener und gescheiterter Versuche – von Südtirol bis Katalonien, von Nordirland bis Kosovo – werden Bedingungen für eine erfolgreiche Konfliktlösung benannt.
II. Ethno-nationale Problemlagen und Konfliktregulierung
1. Akteure und Strukturen ethno-nationaler Konflikte
1.1. Das Modell Nationalstaat: Ethnos und Demos
1.2. Charakteristika ethno-nationaler Gruppen
1.3. Ethno-nationale Konflikte: Interessen und Identitäten
1.4. Typologie von Minderheitensituationen
2. Strategien zur Konfliktregulierung
2.1. Eliminierung von Differenz
2.2. Kontrolle von Differenz
2.3. Anerkennung von Differenz
III. Innerstaatlicher Minderheitenschutz
1. Typen und Elemente von Minderheitenrechten
2. Minderheitenschutz in der Praxis
2.1. Sami-Gesetzgebung in Skandinavien
2.2. Volksgruppengesetz in Österreich
2.3. Minderheitengesetz in Ungarn
2.4. Neuere Ansätze in Slowenien und Estland
3. Begünstigende Bedingungen für Minderheitenschutz
4. Probleme und Lösungspotential von Minderheitenrechten
IV. Bilateraler Minderheitenschutz
1. Elemente und Typen zwischenstaatlicher Regelungen
2. Bilaterale Verträge und Abkommen
2.1. Finnisch-Schwedische Aland-Vereinbarung (1921)
2.2. Deutsch-Dänische Vereinbarungen (1955)
2.3. Polens Nachbarschaftsverträge (1991-94)
2.4. Ungarns Verträge mit der Slowakei (1995) und Rumänien (1996)
2.5. Gescheiterte bilaterale Regelung: Deutsch-Polnisches Oberschlesien-Abkommen (1922)
2.6. Zusammenfassung
3. Gemeinsame Konfliktbearbeitung
3.1. Italienisch-Österreichische Südtirolpolitik (1946-92)
3.2. Britisch-Irische Nordirlandpolitik (1973-98)
3.3. Italienisch-Jugoslawische Triestpolitik (1947-75)
3.4. Gescheiterte Konfliktbearbeitung: Griechisch-Türkische Zypernpolitik (1960-74)
3.5. Zusammenfassung
4. Begünstigende Bedingungen für bilaterale Konfliktregulierung
5. Probleme und Lösungspotential zwischenstaatlicher Regelungen
V. Konkordanzdemokratie
1. Formen und Elemente von Machtteilung
2. Konkordanzdemokratien in der Praxis
2.1. Schweizer Formeln
2.2. Parität und Proporz in Belgien
2.3. Ethnischer Proporz in Südtirol
2.4. Gescheiterte Versuche I: Zypern (1960-63)
2.5. Gescheiterte Versuche II: Nordirland (1973-74)
2.6. Neuere Ansätze: Bosnien (1995) und Nordirland (1998)
3. Begünstigende Bedingungen für Konkordanzmodelle
4. Probleme und Lösungspotential geteilter Macht
VI. Territoriale Lösungen
1. Typen und Elemente territorialer Regelungen
2. Territorialautonomie
2.1. Südtirols "Doppelautonomie
2.2. Alands dynamische Autonomie
2.3. Korsikas Verwaltungsautonomie
2.4. Gescheiterte Autonomie: Kosovo (1946-89)
2.5. Zusammenfassung
3. Föderale Strukturen
3.1. Kantonsmodell der Schweiz
3.2. Föderalisierung Belgiens
3.3. Autonomiestaat Spanien
3.4. Gescheiterte Föderalisierung: Tschechoslowakei (1989-92)
3.5. Zusammenfassung
4. Begünstigende Bedingungen für territoriale Regelungen
5. Probleme und Lösungspotential territorialer Machtteilung
VII. Ergebnisse und Optionen
1. Begünstigende Faktoren und kollektive Lernprozesse
2. Schwächen und Stärken der Regelungsmodelle
3. Nutzen für die praktische Konfliktbearbeitung
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Personen für Auswege aus dem Bürgerkrieg
Ulrich Schneckener
Ulrich Schneckener, geboren 1968, ist Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Osnabrück. Zuletzt erschienen in der edition suhrkamp Auswege aus dem Bürgerkrieg (es 2255), wofür Ulrich Schneckener mehrere Preise erhielt, und Transnationaler Terrorismus (es 2374).
Ulrich Schneckener, geboren 1968, ist Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Osnabrück. Zuletzt erschienen in der edition...