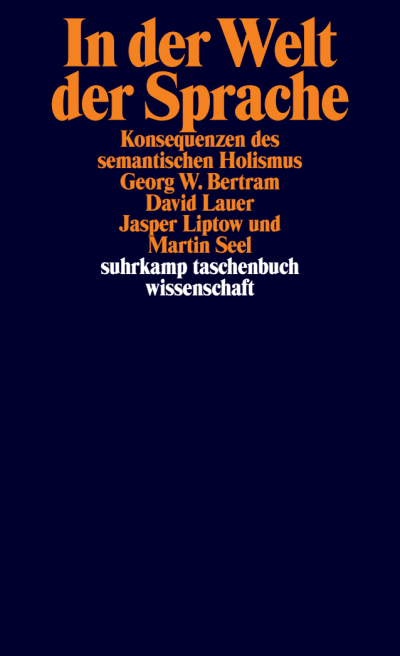In der Welt der Sprache
Konsequenzen des semantischen Holismus
Von Georg W. Bertram, David Lauer, Jasper Liptow und Martin Seel
inkl. MwSt.
In der Welt der Sprache
Konsequenzen des semantischen Holismus
Von Georg W. Bertram, David Lauer, Jasper Liptow und Martin Seel
In systematischer Absicht verfolgen die Autoren die Geschichte des Holismus in der analytischen und der (neo-)strukturalistischen Sprachphilosophie – von Hilbert und Saussure bis hin zu Derrida und Davidson. In der Konsequenz dieser Darlegung kommt es zu einer weitreichenden Revision sowohl des linguistic turn als auch der neueren Versuche, diesen zugunsten verschiedener Spielarten der Philosophie des Geistes zu verabschieden. »In der Welt der Sprache« zu sein heißt, als sprachlich Handelnde...
Mehr anzeigen
In systematischer Absicht verfolgen die Autoren die Geschichte des Holismus in der analytischen und der (neo-)strukturalistischen Sprachphilosophie – von Hilbert und Saussure bis hin zu Derrida und Davidson. In der Konsequenz dieser Darlegung kommt es zu einer weitreichenden Revision sowohl des linguistic turn als auch der neueren Versuche, diesen zugunsten verschiedener Spielarten der Philosophie des Geistes zu verabschieden. »In der Welt der Sprache« zu sein heißt, als sprachlich Handelnde inmitten der sozialen und naturalen Welt zu sein, die für die Beteiligten auf eine besondere Weise zugänglich und hierdurch bedeutsam wird.
Teil I: Formalistischer Holismus
Holismus in der frühen analytischen Philosophie:
1.1 Der holistische Grundgedanke der impliziten Definition
1.2 David Hilberts Begriff der impliziten Definition
1.2.1 Hilberts Begriff der impliziten Definition
1.2.2 Implizite Definition und semantischer Holismus
1.2.3 Unbestimmtheit und Anwendung implizit definierter Begriffe
1.3 Der Gedanke der impliziten Definition bei Moritz Schlick
1.3.1 Implizite und konkrete Definition
1.3.2 Form und Inhalt
1.3.3 Bedeutung und Verifikation
1.4 Implizite Definition als Grundbegriff einer inferentiali-stischen Bedeutungstheorie bei Wilfrid Sellars
1.4.1 Implizite Definition und inferentieller Gehalt
1.4.2 Sprache als Spiel
1.4.3 Syntax als Semantik
Holismus im Strukturalismus:
2.1 Der strukturalistische Grundgedanke: Identität als sprachlicher Wert
2.1.1 Der doppelte Bruch mit dem Positivismus
2.1.2 System, Wert und Differenz
2.1.3 Zweiseitigkeit des Sprachzeichens
2.2 Die Abstraktion sprachlicher Strukturen bei Ferdinand de Saussure
2.2.1 Langue und parole
2.2.2 Form und Substanz
2.2.3 Saussures Ambivalenz
2.3 Die Dynamisierung sprachlicher Strukturen bei Roman Jakobson
2.3.1 Zur Trennung von Diachronie und Synchronie
2.3.2 Die funktionale Konstitution sprachlicher Strukturen
2.3.3 Funktion und Signifikanz in sprachlichen Strukturen
2.4 Die Formalisierung sprachlicher Strukturen bei Louis Hjelmslev
2.4.1 Algebra der Sprache
2.4.2 Inhaltsform und Ausdrucksform
2.4.3 Die Aporie der Materie
Teil II: Postformalistischer Holismus
Die Welthaltigkeit der Sprache:
4.1 Die Genese des postformalistischen Holismus
4.2 Der Grundgedanke
4.3 Die Auflösung der Probleme des Formalismus
4.4 Der Holismus im postformalistischen Holismus
Maurice Merleau-Ponty: Die Dynamizität sprachlicher Bedeutung und die veränderlichen Strukturen der Wahrnehmung:
5.1 Die sprechende Sprache
5.1.1 Ausdruckverhalten nach dem Paradigma der körperlichen Geste
5.1.2 Das Hirngespinst einer reinen Sprache
5.1.3 Ausdruck in der Kunst
5.2 Die Entwicklung der leiblichen Sinnlichkeit und die Konstitution sprachlicher Artikulation
5.2.1 Die Entstehung und Entwicklung der Wahrnehmung
5.2.2 Die Entstehung und Entwicklung des Ausdrucks
5.2.3 Die Dynamizität der Wahrnehmung und des sprachlichen Ausdrucks
5.3 Die Wahrnehmungshaltigkeit des Sprachlichen
Jacques Derrida: Die offene Struktur von Zeichen und Gegenständen:
6.1 Probleme des traditionellen Zeichenbegriffs
6.1.1 Anwesenheit von Gegenständen
6.1.2 Autonomie von Zeichen
6.2 Zeichengegenstände und Struktur
6.2.1 Spuren als Spuren von Spuren
6.2.2 Différance als Grundbegriff der Beziehungen zwischen Zeichen
6.2.3 Die strukturale Idealität von Spuren
6.2.4 Wiederholung, Veränderung und Intersubjektivität
6.3 Der Zusammenhang von Zeichen und nichtzeichenartigen Gegenständen
6.3.1 Die Gleichursprünglichkeit von Zeichengegenständen und nichtzeichenartigen Gegenständen
6.3.2 Beziehungen nichtzeichenartiger Gegenstände
6.3.3 Der konstitutive Zusammenhang von Zeichengegenständen und nichtzeichenartigen Gegenständen
6.3.4 Umfassende Praktiken mit nichtzeichenartigen Gegenständen und Praxis als Spiel
6.4 Derridas Semantik sprachlicher Zeichen
Donald Davidson: Perspektivischer Externalismus:
7.1 Radikale Interpretation
7.2 Triangulation
7.3 Perspektivischer holistischer Externalismus
7.4 Die Individualität und Dynamizität sprachlicher Praxis
7.5 Postformalistischer Holismus und Reduktionismus
John McDowell: Weltoffenheit und Erfahrung:
8.1 Formalismus und Cartesianismus
8.2 Interpretation, Externalismus und Gehalt de re
8.3 Demonstrativer Gehalt und die Unbegrenztheit des Begrifflichen
8.4 Begriffliche Sinnlichkeit
8.5 Sinnliche Begriffe
8.6 Zweite Natur
Schlussbetrachtung:
9.1 Welt
9.2 Praxis
9.3 Wahrnehmung
9.4 Philosophie
Holismus in der frühen analytischen Philosophie:
1.1 Der holistische Grundgedanke der impliziten Definition
1.2 David Hilberts Begriff der impliziten Definition
1.2.1 Hilberts Begriff der impliziten Definition
1.2.2 Implizite Definition und semantischer Holismus
1.2.3 Unbestimmtheit und Anwendung implizit definierter Begriffe
1.3 Der Gedanke der impliziten Definition bei Moritz Schlick
1.3.1 Implizite und konkrete Definition
1.3.2 Form und Inhalt
1.3.3 Bedeutung und Verifikation
1.4 Implizite Definition als Grundbegriff einer inferentiali-stischen Bedeutungstheorie bei Wilfrid Sellars
1.4.1 Implizite Definition und inferentieller Gehalt
1.4.2 Sprache als Spiel
1.4.3 Syntax als Semantik
Holismus im Strukturalismus:
2.1 Der strukturalistische Grundgedanke: Identität als sprachlicher Wert
2.1.1 Der doppelte Bruch mit dem Positivismus
2.1.2 System, Wert und Differenz
2.1.3 Zweiseitigkeit des Sprachzeichens
2.2 Die Abstraktion sprachlicher Strukturen bei Ferdinand de Saussure
2.2.1 Langue und parole
2.2.2 Form und Substanz
2.2.3 Saussures Ambivalenz
2.3 Die Dynamisierung sprachlicher Strukturen bei Roman Jakobson
2.3.1 Zur Trennung von Diachronie und Synchronie
2.3.2 Die funktionale Konstitution sprachlicher Strukturen
2.3.3 Funktion und Signifikanz in sprachlichen Strukturen
2.4 Die Formalisierung sprachlicher Strukturen bei Louis Hjelmslev
2.4.1 Algebra der Sprache
2.4.2 Inhaltsform und Ausdrucksform
2.4.3 Die Aporie der Materie
Teil II: Postformalistischer Holismus
Die Welthaltigkeit der Sprache:
4.1 Die Genese des postformalistischen Holismus
4.2 Der Grundgedanke
4.3 Die Auflösung der Probleme des Formalismus
4.4 Der Holismus im postformalistischen Holismus
Maurice Merleau-Ponty: Die Dynamizität sprachlicher Bedeutung und die veränderlichen Strukturen der Wahrnehmung:
5.1 Die sprechende Sprache
5.1.1 Ausdruckverhalten nach dem Paradigma der körperlichen Geste
5.1.2 Das Hirngespinst einer reinen Sprache
5.1.3 Ausdruck in der Kunst
5.2 Die Entwicklung der leiblichen Sinnlichkeit und die Konstitution sprachlicher Artikulation
5.2.1 Die Entstehung und Entwicklung der Wahrnehmung
5.2.2 Die Entstehung und Entwicklung des Ausdrucks
5.2.3 Die Dynamizität der Wahrnehmung und des sprachlichen Ausdrucks
5.3 Die Wahrnehmungshaltigkeit des Sprachlichen
Jacques Derrida: Die offene Struktur von Zeichen und Gegenständen:
6.1 Probleme des traditionellen Zeichenbegriffs
6.1.1 Anwesenheit von Gegenständen
6.1.2 Autonomie von Zeichen
6.2 Zeichengegenstände und Struktur
6.2.1 Spuren als Spuren von Spuren
6.2.2 Différance als Grundbegriff der Beziehungen zwischen Zeichen
6.2.3 Die strukturale Idealität von Spuren
6.2.4 Wiederholung, Veränderung und Intersubjektivität
6.3 Der Zusammenhang von Zeichen und nichtzeichenartigen Gegenständen
6.3.1 Die Gleichursprünglichkeit von Zeichengegenständen und nichtzeichenartigen Gegenständen
6.3.2 Beziehungen nichtzeichenartiger Gegenstände
6.3.3 Der konstitutive Zusammenhang von Zeichengegenständen und nichtzeichenartigen Gegenständen
6.3.4 Umfassende Praktiken mit nichtzeichenartigen Gegenständen und Praxis als Spiel
6.4 Derridas Semantik sprachlicher Zeichen
Donald Davidson: Perspektivischer Externalismus:
7.1 Radikale Interpretation
7.2 Triangulation
7.3 Perspektivischer holistischer Externalismus
7.4 Die Individualität und Dynamizität sprachlicher Praxis
7.5 Postformalistischer Holismus und Reduktionismus
John McDowell: Weltoffenheit und Erfahrung:
8.1 Formalismus und Cartesianismus
8.2 Interpretation, Externalismus und Gehalt de re
8.3 Demonstrativer Gehalt und die Unbegrenztheit des Begrifflichen
8.4 Begriffliche Sinnlichkeit
8.5 Sinnliche Begriffe
8.6 Zweite Natur
Schlussbetrachtung:
9.1 Welt
9.2 Praxis
9.3 Wahrnehmung
9.4 Philosophie
Inhaltsverzeichnis
Bibliografische Angaben
Erscheinungstermin: 19.03.2008
Broschur, 332 Seiten, Sprachen: Deutsch
978-3-518-29444-4
suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1844
Erscheinungstermin: 19.03.2008
Broschur, 332 Seiten, Sprachen: Deutsch
978-3-518-29444-4
suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1844
Suhrkamp Verlag, 1. Auflage, Originalausgabe
12,00 € (D), 12,40 € (A), 17,90 Fr. (CH)
ca. 10,8 × 17,7 × 1,8 cm, 198 g
Mehr anzeigen
Suhrkamp Verlag, 1. Auflage, Originalausgabe
12,00 € (D), 12,40 € (A), 17,90 Fr. (CH)
ca. 10,8 × 17,7 × 1,8 cm, 198 g
Service
Downloads
Umschlag / Cover (Web)Umschlag / Cover (Print)LeseprobeProduktsicherheit
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Sicherheitshinweis entsprechend Art. 9 Abs. 7 S. 2 der GPSR entbehrlich.
Produktsicherheit
Suhrkamp Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Sicherheitshinweis entsprechend Art. 9 Abs. 7 S. 2 der GPSR entbehrlich.
Personen für In der Welt der Sprache
Georg W. Bertram
Autor
Georg W. Bertram ist Professor für theoretische Philosophie (mit Schwerpunkten in Ästhetik und Sprachphilosophie) an der Freien Universität Berlin. Im Suhrkamp Verlag sind zuletzt erschienen: Kunst als menschliche Praxis. Eine Ästhetik (stw 2086) und Die Kunst und die Künste. Ein Kompendium zur Kunsttheorie der Gegenwart (hg. zus. mit Stefan Deines und Daniel Martin Feige, stw 2346).
Georg W. Bertram
Autor
Georg W. Bertram ist Professor für theoretische Philosophie (mit Schwerpunkten in Ästhetik und Sprachphilosophie) an der Freien Universität Berlin....
© Andreas Meichsner
STIMMEN
Leserstimme verfassen
Wir freuen uns auf Ihre Bewertung!
Wir freuen uns auf Ihre Bewertung!
Leserstimme verfassen
Das könnte Ihnen auch gefallen
ENTDECKEN
Im Fokus